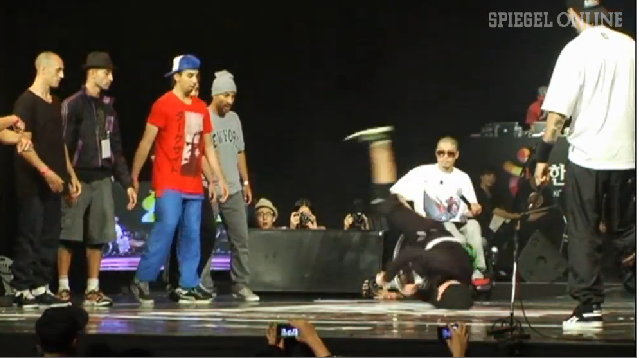Radikalumbau eines Molochs
Grün, grüner, Seoul



22 Millionen Menschen leben in Seoul – jahrzehntelang ein Moloch, grau und voller Autos. Doch Stadtplaner entwickeln hier für viel Geld die Metropole der Zukunft: grün, lebensfroh und mit großen Träumen. Kann der Westen in Südkorea lernen, wie der Öko-Umbau einer Megacity funktioniert?
Wie ein Revolutionär oder Weltverbesserer tritt Kim Ki Ho nicht gerade auf. Der angegraute Hochschulprofessor aus Seoul lächelt viel, während er redet. Jackett und Schlips sitzen korrekt, der Scheitel auch. Er spricht mit leiser Stimme und wirbt geduldig für seine Ideen. Aber was er sagt, ist geradezu umstürzlerisch.
“Zu Fuß gehen ist ein Gefühl von Freiheit”, sagt Kim. Und weil das Leben in Seoul mit Freiheit “nichts zu tun hat”, geht der Hochschullehrer in die Offensive. Er will seine Stadt, diesen Moloch aus Asphalt, Autos und Abgasen, wieder menschlich machen.
Kim will eine freie und Fußgängerstadt Seoul. Ein wahrlich umwälzender Plan.
Das Wort des 57-Jährigen hat Gewicht. Der Professor für Stadt- und Raumplanung an der Universität Seoul ist eine Art graue Eminenz. Er hat in Aachen Architektur und Stadtentwicklung studiert, er ist international gefragter Experte in seinem Fach, und er entwirft in einer Planungskommission im Rathaus Visionen fürs Überleben in der Megastadt. Und er hat es geschafft, Gehör zu finden.
Die Metropole mit mehr als 22 Millionen Menschen erstickt fast an ihrem Wachstum, doch dieses Jahr präsentiert sie sich als Vorbild für einen Richtungswechsel. Als “Welt-Designhauptstadt”, die zweite nach Turin 2008, will sie ein Modell und das “Innovationszentrum der Zukunft” sein.
Hektik, Lärm und Abgase
Seoul soll schöner und grüner werden und Design als Schlüssel dafür dienen. Nicht immer neue Glitzerfassaden sind gefragt, sondern Fußgängerboulevards und verkehrsberuhigte Zonen. Ein Experiment, das wegweisend für andere Megacitys von Jakarta bis Mexico City sein könnte.
Der Richtungswechsel ist für Seoul dringend geboten. Fast die Hälfte der 48,5 Millionen Südkoreaner lebt inzwischen hier, in einem der größten Ballungszentren der Welt. Der Takt in dem brodelnden Kessel wird bestimmt von einem immergleichen Puls aus nimmermüder Betriebsamkeit und hektischem Lärm, vom frühen Morgen bis in die tiefe Nacht.
Seoul ist Verkehr, Seoul ist Verdrängungswettbewerb. Fahrzeuge gegen Fußgänger. Mehr als 2,5 Millionen Autos sind allein in der Hauptstadt registriert, Zigtausende Busse und kaum noch zu zählende Motorräder und Roller bewegen die Menschenmassen durch die Stadt. “Das Leben hier ist ein Kampf”, sagt die junge Politikwissenschaftlerin Kang Bo Ra. “Eine Stunde Spazierengehen ist wie eine Packung Zigaretten rauchen”, sagt Stadtentwicklungsforscher Bahk Hyun Chan.
“Bummeln ist ein sehr schönes Wort, das es in vielen Sprachen so eigentlich nicht gibt”, sagt Experte Kim. “Schon gar nicht auf Koreanisch.” Der Uni-Professor will deshalb die letzten noch nicht wegsanierten Altstadtviertel unbedingt erhalten. Nicht nur wegen ihrer mehr als 600 Jahre alten Geschichte, sondern auch wegen der alten, nicht massenverkehrstauglichen Gassen. Er möchte außerdem mehr und bessere Fußwege, Zebrastreifen, Einbahnstraßen, Fußgängerzonen, Fahrradwege.
Basisdemokratie bis heute ein Fremdwort
Professor Kim steht an der Spitze der Bürgerinitiative Dosi Yondae, was so viel bedeutet wie “Union für eine fußgängerfreundliche Stadt”. Das ist an sich schon bemerkenswert für Korea, wo bis Ende der Achtziger noch die Militärs politisch den Ton angaben und Basisdemokratie bis heute ein Fremdwort ist. Dass er aber auch noch das offene Ohr von Bürgermeister Oh Se Hoon, 49, gefunden und dieser Seoul eine Art ökologische Schönheits-OP verordnet hat, ist überraschend.
“Wir müssen eine neue Balance finden”, sagt Oh. Die Stadt soll wieder zu einem “harmonischen Raum” für Arbeit, Menschen und Natur werden. Viel zu lange sei die Umwelt den wirtschaftlichen Interessen geopfert worden. Nun stehe man an einem “bedeutsamen Wendepunkt”.
Oh spricht gern von seiner Vision für Seoul als “soft city”, in der die Kreativwirtschaft zuhause ist, Kultur und Stadtentwicklung eine neue Rolle spielen und Menschen nicht nur zum Arbeiten leben. Er ist überzeugt: “Design hat die Kraft, die Welt besser zu machen.” Deshalb krempelt er die Stadt um.
Designzentrum mit Grünflächen
Auf dem rund 85.000 Quadratmeter großen Gelände des früheren Dongdaemun-Baseballstadions, das umgeben war von Hunderten kleiner Schneidereien und Wäschestuben, soll für mindestens 250 Millionen Dollar ein hochmodernes Zentrum für Mode und Design entstehen. Herzstück wird ein raumschiffähnliches Monstrum aus Stahl und Glas mit Kongress- und Veranstaltungssälen, Modeschulen und Ausstellungsflächen, das die britische Stararchitektin Zaha Hadid entworfen hat.
Ein weiteres Herzstück wird ein großer Park, der die schier endlosen Autoströme aus dem Zentrum zurückdrängen soll. Für Südkoreas bislang rücksichtslos prosperierende Metropole sind das ganz und gar neue Perspektiven.
Mangels Raum wuchs Seoul bislang statt in die Breite vor allem in die Höhe, in spargelförmigen, tristen Wohntürmen, dicht an dicht: ein Stadt gewordener Alptraum aus Glas, Stahl und Beton.
Aber sie wuchs auch nach unten.
Zum Dinner in die Unterwelt
Seoul – das sind praktisch zwei Städte: jene über der Erde, aber auch eine schillernde Unterwelt. Wo immer ein Abstieg unter die Erde möglich ist, an Zugängen zum weit verzweigten U-Bahnsystem zum Beispiel, verbinden lange Einkaufspassagen die Bahnhöfe. Unter riesigen Straßenkreuzungen, in Unterführungen, aber auch unter Bürohäusern oder Hotels gibt es quirlige traditionelle Märkte und blühende Dienstleistungszentren.
Fitnessstudios, Clubs oder Restaurants wie das beliebte “Hofbräuhaus” im Büro- und Amüsierviertel Gangnam locken oberirdisch oft nur mit einer schmalen Tür, dahinter beginnt der Abstieg.
Bürgermeister Oh mag nicht, wenn sein Berater Kim von einer “Verdrängung der Fußgänger unter die Erde” spricht. Für Oh hatte die “unterirdische Stadtplanung” einen ganz eigenen Stellenwert: “Wir mussten unseren Platz hundertprozentig ausnutzen.” Doch das war gestern.
Heute ist alles anders. Wettbewerbsfähigkeit ist wichtiger denn je, glaubt Oh, “aber nur eine Stadt, in der man gern leben möchte, ist auch eine Stadt, in der man gern investieren möchte”.
Oh ist ein Dauerlächler, der immer nett wirkt und wegen seines jungenhaften Charmes gut ankommt. Für seinen Masterplan suchte der Jurist Nachhilfe in Europa. Er war in Mailand, Brüssel oder Graz, er informierte sich auch in Hamburg über die neue Hafencity. Wieder zu Hause stellte er fest, dass sich auch das Bewusstsein seiner Landsleute verändert hat. “Unsere Menschen wollen endlich Freizeit genießen und sich wohl fühlen können”, glaubt er.
Es war Ohs Vorgänger Lee Myung Bak, der solch “neuem Denken” den Weg bereitet hat. Der heutige Präsident erkannte, dass Seoul mit einer der höchsten Bevölkerungsdichten der Welt nicht grenzenlos weiter wachsen konnte. Lee stellte das öffentliche Verkehrssystem um. Er organisierte Express-Routen für Busse und schuf für sie eigene, staufreie Fahrspuren.
Lee ließ zentrale Verkehrsknotenpunkte beruhigen und ein zubetoniertes Flüsschen im Zentrum reanimieren, den Cheonggyecheon. Er war 1961 erst begraben und dann durch einen mehrspurigen Expressway ersetzt worden. Die sechs Kilometer lange Autobahn führte auf Stelzen quasi durch die Wohnzimmer im Herzen Seouls. Für umgerechnet rund 300 Millionen Euro ließ Lee sie abreißen. Seit gut vier Jahren fließt der Bach wieder auf knapp vier Kilometer Länge und wurde zum Symbol des grünen Aufbruchs.
Oh steht am Fenster im Rathaus und schaut hinab auf eine riesige Rasenfläche, der die Beamten eine für Seouler Verhältnisse geradezu gespenstische Ruhe genießen lässt. Es ist noch gar nicht lange her, da lag die Stadtverwaltung noch an einer der schlimmsten Verkehrsinseln der Stadt. Sechs mehrspurige Hauptstraßen aus allen Himmelsrichtungen trafen sich hier zu einer sternförmigen Riesenkreuzung und umnebelten den Jahrhunderte alten Königspalast Deoksu schräg gegenüber mit einer Dauerwolke aus Abgasen.
Umweltfreundlichkeit als Markenzeichen
Oh ließ andere Verkehrsknotenpunkte im Zentrum beruhigen, unscheinbare Nebenstraßen mit Fußwegen aufhübschen, Grünflächen und Springbrunnen anlegen. Die fußgängerfreundliche Umgestaltung von zunächst 20 wichtigen Straßen der Stadt ist Teil des offiziellen Design-Programms.
“Natürlich bleiben Wirtschaft, Verkehr und Bildung sehr wichtig”, sagt der Bürgermeister – aber “um die Zufriedenheit der Bürger zu steigern, sind Umwelt und Kultur die wichtigsten Faktoren”. In fünf bis zehn Jahren will er Seoul zu einer fußgängerfreundlichen Stadt gemacht haben: “Umwelt soll zu unserem neuen Markenzeichen werden.”
Im Vergleich zu Lees Verkehrsmaßnahmen klingen Ohs Visionen geradezu revolutionär. So will er das “Wunder vom Hangang” vollbringen und die Uferlandschaften des mächtigen Han-Flusses für Mensch und Freizeit rekultivieren. Der mächtige Strom durchschneidet die Stadt von Ost nach West mit rund 50 Kilometern Ufer. Acht- bis zehnspurige Autopisten säumen den Hangang auf beiden Seiten und teilen die Stadt wie eine Demarkationslinie, zum Teil auf Betonstelzen.
Nun soll der Strom zum “neuen Symbol” werden. Oh will mit einer gewaltigen Kraftanstrengung die “Natur entlang des Flusses für die Menschen zurückgewinnen” und zum Paradies für Fahrradfahrer und Jogger entwickeln. Hochhausquartiere sollen zu Wasserfront-Vierteln und die “Hauptstadt zu einer Hafenstadt umgestaltet” werden.
Libeskind baut Giga-Wolkenkratzer
Teil des Plans ist ein neues Wohn- und Geschäftsviertel in Yongsan, das Stararchitekt Daniel Libeskind entworfen hat. Archipelago 21 heißt das Potpourri aus Wohnsilos, Büros und Grünanlagen im Stadtbezirk Yongsan. Den Mittelpunkt soll spätestens 2017 ein 640 Meter hoher Wolkenkratzer bilden, einer der höchsten der Welt. Dafür muss die Autobahn am Nordufer, verkehrte Welt, zum Teil unter die Erde in kilometerlange Tunnel gelegt werden. Dass solche Pläne technisch und finanziell schier unglaublich klingen, stört Oh nicht. “Die Zustimmung der Menschen zeigt, dass wir überzeugen können”, sagt er.
Bevor er vor dreieinhalb Jahren zum Stadtoberhaupt gewählt wurde, war der Jurist nicht nur renommierter Ökoanwalt. Er war auch streitbares Mitglied der größten Umweltinitiative Seouls. Er wechselte nur die Seiten, nicht aber seine Überzeugung. Für die ist Oh bereit, politisch weit zu gehen.
Wie weit? Im Frühsommer sind Kommunalwahlen in Seoul, da will und muss er wieder gewählt werden. Denn Oh Se Hoon hat noch Großes vor: Er möchte seinen Vorgänger ein weiteres Mal beerben. Als Staatspräsident. Das wäre Anfang 2013.
Quelle: Spiegel Online 05.02.2010
Von Manfred Ertel
Link: http://www.spiegel.de/reise/fernweh/0,1518,676024,00.html


















 The most popular bottle in the world.
The most popular bottle in the world.