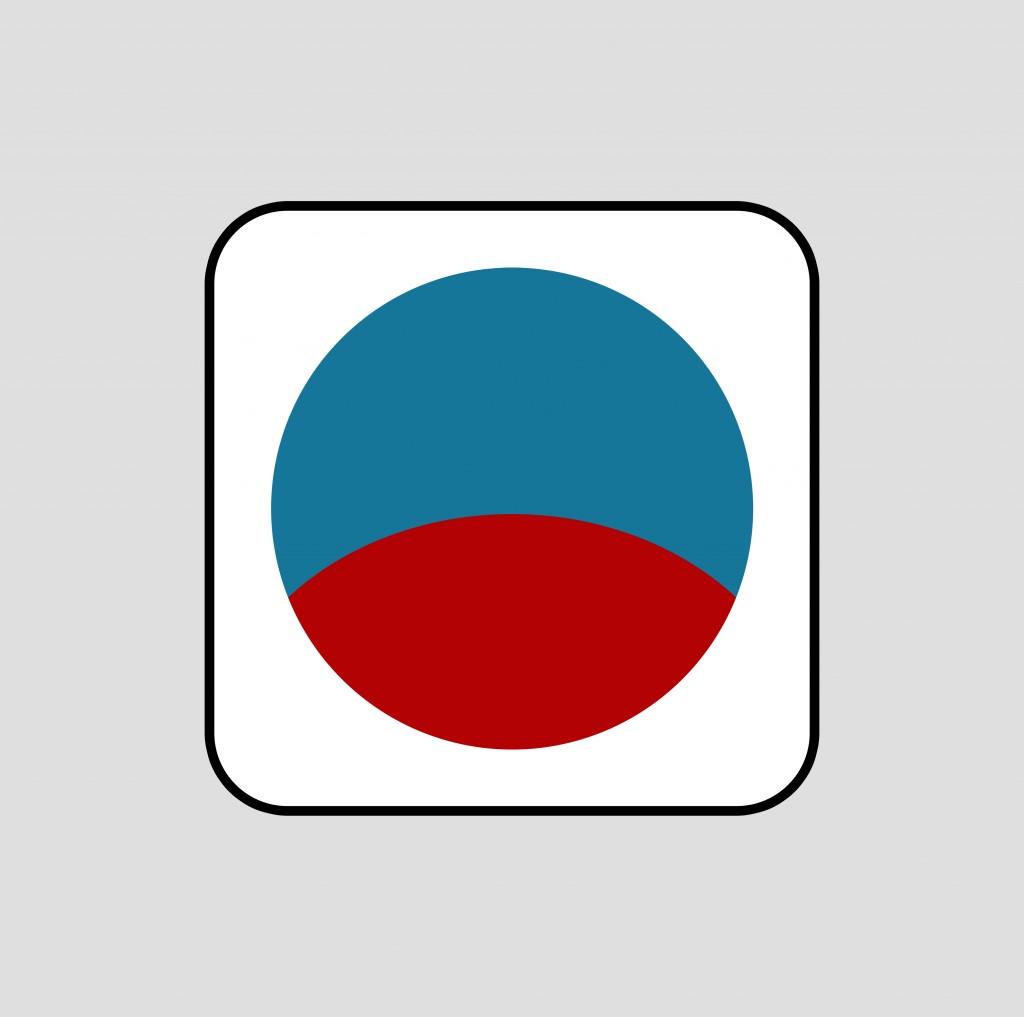Category Archives: Uncategorized
Koreanische Film Tips von Quentin Tarantino
Quentin Tarantino hat seine Top 20 Movies seit er selber Regiseur ist aufgelistet.
Darunter sind 3 Koreansiche Filme!
Ich selber kenne nur “The Host” und “JSA”. Beide sind Top! “Memories of Murder” muss ich dann wohl noch gucken.
The Host
Joint Security Area
Memories of Murder
Alles zum Thema Koreanischen fish cake
Prost Korea
Exports of Korean Rice Wine to Hit $50 Million This Year
Exports of Korea’s traditional rice wine or makgeolli are expected to top US$50 million for the first time this year on rising demand in Japan and China, the Korea Customs Service said on Thursday.
Exports of makgeolli reached $45.3 million in the first 10 months of this year, a close to three-fold increase from the same period in 2010.
Customs attributes the growth to makgeolli’s growing reputation as a healthy drink, and forecasts exports could reach $100 million next year.
Quelle:
http://de.wikipedia.org/wiki/Makgeolli
http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2011/12/02/2011120201354.html
Teenager mit schweiz-koreanischem Hintergrund auf Reserveliste der nationalen Eiskunstlaufmannschaft
Die 14-jährige Claudia Müller, oder wegen ihrer grazilen Schönheit auch “Elfe” genannt, hat es auf die Reserveliste des koreanischen Eiskunstlaufteams geschafft. Vergangene Woche traf sie sich zum ersten Mal mit dem Nationaltrainer und ihren neuen Kollegen, nachdem sie zu einer der fünf Damen ernannt worden war, die gemeinsam mit fünf Herren um einen Platz in der Nationalmannschaft ringen.
Claudia Müller ist die Tochter einer Koreanerin und eines Schweizers, der derzeit als Koch im Grand Hilton Seoul Hotel tätig ist. 2005 kam sie nach Korea, nachdem sie ihre ersten acht Lebensjahre in Indonesien, Thailand und in der Schweiz verbracht hatte. Ihren ersten großen Auftritt hatte sie vergangenen Juli als Partnerin von U-know Yunho von der Boygroup TVXQ in der Eisrevue „Kiss and Cry“.
Der koreanische Eislaufverband veranstaltete kürzlich ein offenes Vortanzen, um Nachwuchs für Eiskunstlaufteams im ganzen Land zu suchen, und Mueller entschied sich nach ihrer Wandlung von einer Einzelläuferin zu einer Eistänzerin anzutreten. Bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang ist der Verband für die Auswahl von Eisläufern in allen vier Disziplinen, dem Damen-Einzellauf, dem Herren-Einzellauf, dem Paarlauf und dem Eistanz verantwortlich. Um die Chancen auf den Olympiasieg zu erhöhen, wurde ein russischer Trainer angeworben, der bereits einige Goldmedaillenträger hervorgebracht hat. Die ausgewählten Eiskunstläufer haben ihr Training am 28. November begonnen.
Um für einen festen Platz im Nationalteam zu kämpfen, hat Claudia Müller im September ihre Schweizer Staatsbürgerschaft abgelegt und die koreanische angenommen. Ihr Ziel beschrieb sie damit, bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang eine Medaille zu gewinnen und so ein Star wie Kim Yu-na zu werden. Mit 1,61 m ist sie für eine Eiskunstläuferin vergleichsweise groß. Dies könnte ihr bei Sprüngen zum Nachteil sein, beim Eistanz aufgrund ihrer schlanken, eleganten Gestalt allerdings einen Vorteil verschaffen. An ihrer neugewählten Disziplin finde sie spannend, dass man eigene Bewegungen und Rhythmus dem Partner anpassen muss, sagte sie in einem Interview.
Mit fünf Jahren begann sie mit dem Eislaufen als Hobby, nun verbringt sie jeden Tag Stunden mit dem Training. Gewöhnlich kommt sie um ein Uhr nachts nach Hause, nur um sechs Stunden später wieder aufzustehen und in die Schule zu gehen. Um trotz wenigen Stunden Schlaf den ganzen Tag durchzuhalten, hat sie ein Geheimrezept: „Wenn ich kraftlos bin, esse ich für den augenblicklichen Energieschub hausgemachte Spätzle von meinem Vater.“
Quelle: http://english.chosun.com/site/data/html_dir/2011/11/25/2011112500874.html
Hallyu – Die Koreanische Welle
Koreanische Welle, auch unter dem koreanischen Begriff „Hallyu“ bekannt, bezeichnet die weltweit ansteigende Popularität der zeitgenössischen südkoreanischen Pop-Kultur im 21. Jahrhundert. Dieses Phänomen zeigt sich in ganz Asien, vor allem in China, Japan, Taiwan, Hongkong, Vietnam, Nepal, Thailand, Indonesien und den Philippinen,greift aber auch nach Indien, in den mittleren Osten, sowie nach Nordafrika und Südamerika über.Durch das Internet und Videoplattformen wie Youtube erreicht die Koreanische Welle auch ein Nischenpublikum in Nordamerika und teilweise auch in Europa.
Die Koreanische Welle, die zu Beginn vor allem durch Dramen (K-Drama) und Pop-Musik losgetreten wurde, weitet sich heute auf Gebiete wie Filme, Essen, Sprache, Computerspiele, Mode und Taekwondo aus. Der koreanische Begriff „Hallyu“ bedeutet „Welle“ und wurde 1999 in China geprägt, indem Pekinger Journalisten über die rapide anwachsende Popularität südkoreanischer Güter in China schrieben. Zu Beginn war der Erfolg weder beabsichtigt noch geplant. Erst nachdem der Erfolg sichtbar wurde, produzierte man strategisch und gezielt Fernsehserien und Musik für den asiatischen Markt. Dieser zunehmende Kulturexport wird auch vom südkoreanischen Kulturministerium unterstützt. Dabei ziele man nicht mehr nur auf den asiatischen Raum ab, sondern auf den Weltmarkt.
Als Ursachen für den Erfolg in China werden unter Anderem die gemeinsame Kultur und Geschichte sowie der Konfuzianismus genannt.Die Themen südkoreanischer Seifenopern handeln vorwiegend von Familie, Liebe und Moral und enthalten wenig Gewalt oder Sex. Ein weiterer Grund für die Beliebtheit südkoreanischer Serien im asiatischen Raum soll die äußerliche Attraktivität der Darsteller sein.
Gerade die südkoreanische Musikindustrie ist aufgrund des kleinen, und aktuell schrumpfenden, einheimischen Musikmarktes auf Export ausgerichtet.
Südkorea gehört zu den zehn Nationen, die am meisten kulturelle Güter exportieren.Der Begriff ist mittlerweile auch ein Akronym, das auf die schnellwachsende Wirtschaft Südkoreas verweist („Wunder am Han-Fluss“, kor. 한강의 기적, Hangangeui Kijeok)
Der Tourismus Südkoreas wird durch den Erfolg der „Welle“ ebenfalls beflügelt. Viele Reiseveranstalter bieten Pauschalreisen zu den Drehorten südkoreanischer Seifenopern an.Laut Fremdenverkehrsamt kämen jedes Jahr eine Million Touristen um die Schauplätze zu besichtigen.
Vor allem der Fernsehspielreihe „Winter Sonata“ gelang reißender Absatz in Japan und China und der Hauptdarsteller Bae Yong-joon avancierte zum Traummann der Hausfrauen.
Zudem führt die Hallyu in China dazu, dass einige Chinesen zum Christentum konvertieren, das durch südkoreanische Missionare verbreitet wird.
Auch auf das stalinistische Nordkorea soll die Koreanische Welle Einfluss haben, indem CDs und DVDs mit Musik und Fernsehserien über die Gebirge eingeschmuggelt werden.
In einigen Staaten wie China, Thailand oder Japan stößt der Import koreanischer Kultur zunehmend auf eine ablehnende Haltung, so dass Quotenregeln eingeführt worden sind.Vor allem nach dem erfolgreichen Abschneiden der südkoreanischen Fußballnationalmannschaft bei der WM 2002, die Japan und Südkorea gemeinsam austrugen, stiegen antikoreanische Kommentare stark an. Aus Sicht vieler Japaner sei Japan für den wirtschaftlichen Aufstieg (Süd-)Koreas verantwortlich.
Im Hollywood Bowl in den USA findet jedes Jahr das Korean Music Festival statt, veranstaltet von der Korea Times, bei dem die bekanntesten Musiker Südkoreas auftreten. http://www.koreanmusicfestival.com/
Südkoreanische Schauspieler gehören mittlerweile zu den am bestbezahlten Schauspielern außerhalb Hollywoods. Bae Yong-joon, Star des Dramas „Winter Sonata“ verdient etwa fünf Millionen US-Dollar für einen Film. Die international populärsten Sänger und Musikgruppen sind TVXQ, Super Junior, Rain, Lee Hyori, BoA, Se7en, Girls’ Generation, Kara, 2NE1 und Big Bang.Die Wonder Girls starten im Juni 2010 ihre Amerika-Tournee. Sie erreichten schon zuvor im Oktober 2009 den 76. Platz der Billboard Hot 100 in den USA.
Auch in Zeiten der Globalisierung bleiben das Nationalbewusstsein und die Verbundenheit mit dem eigenen Land Faktoren, die das Konsumverhalten der Menschen maßgeblich bestimmen. So verwundert es nicht, dass etwa eine Betonung kultureller Überlegenheit der koreanischen Kultur in anderen Ländern auf Ablehnung stößt und bisweilen nationalistischen Furor provoziert.
Patriotismus und blinder Nationalismus wurde auch für den Erfolg des Filmes Dragon Wars (2007) verantwortlich gemacht, der international ausschließlich schlechte Kritiken erhielt. Der Film hatte 8 Millionen Besucher in Südkorea. Viele südkoreanische Zuschauer waren stolz, dass auch ein Koreaner einen Blockbuster drehen kann.
Ken-Kanryu
Ken-Kanryū bezeichnet die die Gegenbewegung und Ablehnung der Koreanischen Welle in Japan. Diese ist insbesondere in Mangas zu finden. So stand der Manga Hating the Korean Wave (jap. マンガ 嫌韓流, Manga Kenkanryū) für über vier Monate in der japanischen Bestsellerliste. 2011 sorgte der Manga K-POP Boom Netsuzō Setsu o Oe! (dt. Analyse der K-Pop-Boom-Lügen) für Aufsehen, in dem die Umstände der südkoreanischen Unterhaltungsindustrie kritisiert werden. So geht der Comic auf den Fall Jang Ja-yeon ein, eine Schauspielerin, die Selbstmord beging, da sie von ihren Managern zum Sex gezwungen wurde. Auch die Gruppen Girls’ Generation und Kara, die Ende 2010 große Popularität in Japan erreichten, werden in diesem Kontext dargestellt.
Quellle : http://de.wikipedia.org/wiki/Koreanische_Welle, http://german.visitkorea.or.kr/ger/CU/CU_GE_5_8_1.jsp
Korea 2.0
Waffen statt Brot: Absurde Militärübung in Nordkorea
Last Days of Autumn Season

Women take a break during lunch under trees with colored leaves in Seoul, South Korea, Friday, Nov. 4, 2011. (AP / Lee Jin-man)
Women? Ajumas 😉
Mehr tolle Herbstbilder von der ganzen Welt:
http://designyoutrust.com/2011/11/25/last-days-of-autumn-season/
Südkorea auf der Überholspur nach Digitalien
Präsentation von Samsungs Galaxy S: Südkorea
Von Malte E. Kollenberg, Seoul
Daten, Daten, Daten. Überall, 24 Stunden am Tag, fliegen virtuelle Informationen durch die Luft. Das IT-Unternehmen Cisco hat diesen Mittwoch eine Studie vorgestellt, der zufolge die Datenflut in den nächsten Jahren rasant steigen wird. Dem Global IP Traffic Forecast zufolge wird sich der globale Datenverkehr im Jahr 2015 verglichen mit dem Jahr 2010 vervierfacht haben. Die treibenden Kräfte hinter diesem rasanten Anstieg benennt die Studie ebenfalls: “Eine steigende Zahl von Geräten, Internetnutzern und Videoübertragungen sowie höhere Bandbreiten.” Demnach erhöht sich in Deutschland die Bandbreite von durchschnittlich 12 Mbit/s in 2010 auf 46 Mbit/s im Jahr 2015.
Südkorea ist schon heute viel weiter. Die durchschnittliche Breitbandverbindung bringt es dort mittlerweile auf 100 Mbit/s. In keinem anderen Land der Welt sind die Internetanschlüsse schneller als in Südkorea. Die Zukunftspläne des Landes gehen aber noch viel weiter: Bereits Ende 2012 soll in Südkorea eine Bandbreite von 1 Gbit/s Standard sein.
Aber auch in anderer Hinsicht hängt Südkorea Deutschland ab. Laut einer OECD-Statistik aus dem Jahr 2009 verfügen 99 Prozent der Koreaner über einen Breitband-Internetanschluss, in Deutschland sind es nur 95 Prozent der Bevölkerung. Ein Mobiltelefon hat sowieso eigentlich jeder Südkoreaner. Dem globalen Trend folgend wächst aber auch in Südkorea kaum ein Markt so rasant wie der für Smartphones. Der Unterschied zu anderen Ländern: Viele Koreaner freunden sich viel schneller mit neuer Technik an. Im März hat die Korea Communications Commission das Erreichen der Marke von zehn Millionen Smartphone-Nutzern bereits als den Eintritt ins “Smart Age” – ein neues intelligentes Zeitalter – gefeiert.
Das Leben in Südkorea ist vollständig von mobiler Digitaltechnologie bestimmt. Auch der 26 Jahre alte Germanistik-Student In Sae Yeol kann sich ein Leben ohne sein Smartphone gar nicht mehr vorstellen. “Das vereinfacht den Alltag ungemein”, sagt er begeistert. Jeden Morgen fährt er mit Bus und U-Bahn zur Uni. An der Haltestelle richtet er die Kamera seines Galaxy Tab auf den QR Code, eine Art Barcode über dem Busplan, und schon werden ihm aktuelle Informationen auf seinem Tablet-PC angezeigt. Mögliche Buslinien, welcher Bus als nächster kommt und wie viele Minuten er noch Zeit hat, um seine Geldkarte aufzuladen, zum Beispiel.
Nur mit aufgeladenem Chip kann man den öffentlichen Nahverkehr nutzen
Denn eine T-Money-Geldkarte ist Voraussetzung, um den öffentlichen Nahverkehr in Seoul benutzen zu können. Die Bezahlung läuft komplett Digital ab. Ein Papierticket? Seit Einführung des T-Money-Systems 2004 gibt es so etwas quasi nicht mehr. Am Eingang jeder U-Bahn-Station sind digitale Lesegeräte, die den RFID-Chip in der kleinen Plastikkarte oder dem Mobiltelefonanhänger auslesen. Nur wer den Chip vorher aufgeladen hat, für den öffnen sich die Drehkreuze, und er kann in die U-Bahn eintreten. Am Ziel angekommen wird die Karte beim Verlassen der Station wieder über das Lesegerät gezogen. Doch nicht nur U-Bahnen, auch Busse, Taxen und selbst die Nahverkehrsnetze in anderen Städten, beispielsweise der Hafenstadt Busan, lassen sich mit derselben T-Money-Karte nutzen. Damit nicht genug: Selbst beim Imbiss um die Ecke kann mit T-Money bezahlt werden.
Dabei war der Smartphone-Boom in Korea ursprünglich lange nicht so stark wie in Europa oder den USA. Erst mit dem reichlich späten Markteintritt des iPhone im November 2009 kam auch der koreanische Smartphone-Markt in Fahrt. Für Ende 2011 geht die Korea Communications Commission von einer Verdoppelung der Smartphone-Nutzer auf 20 Millionen aus. Die Anstrengungen der Koreaner zahlen sich aus. Im Networked Society Index des IT-Unternehmens Ericsson und der Unternehmensberatung Arthur D. Little, vorgestellt am 11. Mai 2011, rangiert Seoul mit Singapur und Stockholm auf den ersten drei Plätzen der am besten vernetzten Städte weltweit.
In Deutschland kaum genutzt, hat sich auch das Digital Media Broadcasting (DMB), das digitale Handy-Fernsehen, in Korea durchgesetzt. Zum einen ist die Technologie in Korea entwickelt worden, zum anderen gibt es kaum ein Gerät, das nicht mobiles Fernsehen unterstützt. Selbst das weltweit erhältliche Samsung Tablet Galaxy Tab ist in Korea mit einem DMB-Empfänger erhältlich. Wer auf dem Weg zur Arbeit oder in die Uni nicht Nachrichten auf dem Smartphone liest oder mit Freunden chattet, der sieht fern. Telefoniert wird mit dem Telefon eigentlich kaum noch.
Parkleitsystem für Hörsaalplätze
Smartphone oder Tablet gehören in jeder Situation dazu. In der Universität angekommen holt Sae Yeol wieder sein Galaxy Tab heraus. Er will in die Bibliothek. Eine App zeigt ihm in Echtzeit, in welchem Lesesaal noch Plätze frei sind. Die Anzeige auf dem Smartphone-Bildschirm funktioniert im Grunde wie ein Parkleitsystem. “Ganz nett” findet das Choi Jun Ho, Direktor des User Experience Lab an der Yonsei Universität. “Aber der App- und Software-Markt in Korea hinkt anderen Teilen der Welt noch etwas hinterher”, sagt er.
Eine echte Killer-Applikation für Korea sieht er bisher nicht. “Nehmen sie QR-Codes. Das hat zwar Potential, und wir werden davon noch mehr sehen, als es ohnehin schon gibt, aber die Leute wollen mehr als automatisiert auf eine Internetseite gelenkt werden.” Angebote wie QR-Codes oder ortsbezogenen Dienste wie Foursquare werden zukünftig noch stärker mit anderen, beispielsweise Twitter und Facebook, verknüpft werden, ist sich Choi sicher.
Kostenloser SMS-Chat
Eine Applikation, die vielleicht gerade dabei ist, Koreas Facebook zu werden, ist Kakao Talk. Im Grunde ist das kleine Programm nichts anderes als ein SMS-Dienst. Wichtigster Unterschied zur herkömmlichen Textnachricht: Die Kakao-Talk-Nutzung ist kostenlos. Nicht einmal die App kostet etwas. In 14 Monaten hat es die kleine Software-Firma mit ihrem Programm auf 14 Millionen Nutzer gebracht. Koreanische Internetportale wie Naver oder Daum, die in Korea ähnliche Services wie Google anbieten, haben reagiert und mittlerweile Sprachservices in ihre Applikationen integriert. Kakao Talk bleibt bisher bei der simplen Textnachricht mit Foto oder Videoanhang. “Stabilität und eine angenehme Nutzererfahrung sind erst mal das Wichtigste”, erklärte der Kakao-Talk-CEO Lee Je Beom beim Seoul Digital Forum.
Die Benutzerzahlen geben Kakao Talk recht. Auch In Sae Yeols Kommunikation findet mittlerweile fast ausschließlich über den Nachrichtendienst statt. Kurz bevor der Student in der Bibliothek angekommen ist, hat ihm ein Kommilitone geschrieben und gefragt, wo sie zusammen lernen wollen. Mit dem Tablet-PC hat er nach freien Plätzen geschaut. Jetzt treffen sie sich im Computerraum. Drei Plätze sind noch frei, oder wie es die App ausdrückt: 10,3 Prozent.
Quelle: Spiegel-Online.de